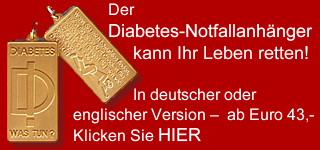Zuckerkrank und atemlos TEIL 2
Diabetes und COPD – Gegenseitige Beeinflussung Teil 2
Von Mag. Christopher Waxenegger*
Die beiden Krankheiten haben auf den ersten Blick nichts gemein, immerhin ist beim Diabetes der Zucker im Blut erhöht während bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) das Atmen Schwierigkeiten bereitet. So scheint es zumindest. Bei genauerem Hinsehen offenbaren sich allerdings zahlreiche Gemeinsamkeiten.
COPD und seine Folgen für Diabetes
Die zugrundeliegenden Mechanismen, wie und warum es bei manchen Menschen zu einer Entzündung des Lungengewebes kommt und schlussendlich COPD entsteht, liegen zum Teil noch im Dunkeln. Die Entzündungsreaktion unterscheidet sich jedoch von jener bei Asthma, wodurch sich das in der Regel schlechte Ansprechen von Menschen mit COPD auf inhalative Kortikosteroide („Kortison“) erklärt. Auch die vermehrte Sekretion von zähem Schleim und die dadurch verursachte Neigung zu bakteriellen Lungeninfektionen grenzen COPD von der Diagnose Asthma ab.
COPD konnte in einigen Studien als Prädiktor für Diabetes identifiziert werden:
- Patienten mit schwerer COPD haben eine höhere Diabetes-Prävalenz
- COPD erhöht generell die Wahrscheinlichkeit an Typ-2-Diabetes zu erkranken
Andererseits schränkt Atemnot Menschen mit COPD bei ihren körperlichen Tätigkeiten ein. Bewegungsmangel wiederum leistet dem sogenannten metabolischen Syndrom Vorschub, einem Symptomkomplex aus Übergewicht, Bluthochdruck, schlechten Fettwerten und hohen Blutzucker, womit ein bereits in Teil 1 erwähnter Risikofaktor für die Entstehung von Diabetes ins Spiel kommt. Des Weiteren ist bekannt, dass die bei schwerer COPD notwendigen Kortikosteroide ebenso in die körpereigene Blutzuckerregulation eingreifen.
Auswirkungen auf die Diabetes-Therapie
Menschen mit Diabetes und COPD werden grundsätzlich nicht anderes therapiert als ohne COPD. Das Ziel sollte eine möglichst normnahe Blutzuckereinstellung sein, um eventuelle zuckerbedingte Schäden an den Lungen zu vermeiden. Außerdem ist es empfehlenswert den behandelnden Diabetologen über die Diagnose COPD zu informieren. Auf diese Weise kann dieser das erhöhte Infektionsrisiko bei seinen Therapieentscheidungen berücksichtigen. Im Übrigen ist Metformin, ein weitverbreitetes Medikament zur Behandlung von T2D, bei hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz (verminderter Sauerstoffgehalt im Blut aufgrund einer Störung beim Gasaustausch in der Lunge) ungeeignet. Die Behandlung mit inhalativen und/oder oralen Kortikosteroiden kann zudem eine Anpassung der antidiabetischen Therapie notwendig machen.
Auswirkungen auf die COPD-Therapie
Der Schweregrad bei COPD wird anhand der Lungenfunktion, der Symptome und der Rate jährlicher Exazerbationen festgelegt. Auf Basis dieser Einschätzung erfolgt die Wirkstoffwahl für die inhalative Dauertherapie. Zum Einsatz kommen entweder β2-Rezeptoragonisten (Sympathomimetika) oder Muskarinrezeptor-Antagonisten (Parasympatholytika) bzw. eine Kombination aus beiden. Sie öffnen die Bronchien, erleichtern das Atmen und werden zur Linderung oder Vorbeugung von Beschwerden eingesetzt.
Für die Inhalation kann aus vier Inhalator-Typen gewählt werden:
- Dosieraerosole
- Pulverinhalatoren
- Respimat Soft Inhaler
- Stationärer Vernebler
Inhalative Kortikosteroide spielen bei Menschen mit reiner COPD eine eher untergeordnete Rolle. Sie kommen allerdings bei Mischformen („Asthma-COPD-Overlap“) in Betracht. Ferner profitieren Patienten mit Eosinophilie (erhöhte Anzahl eosinophiler Granulozyten im Blut) und solche mit wiederholten Exazerbationen. Liegt parallel ein behandlungsbedürftiger Diabetes vor, ist eine strenge Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich, da Kortikosteroide Auswirkungen auf den Blutzuckerhaushalt haben können.
Zusammengefasst
Diabetes scheint den Fortschritt einer COPD zu fördern, COPD wiederum das Auftreten eines Diabetes. Obwohl diese Assoziation bekannt ist, konnte bisher nicht eindeutig belegt werden, ob es sich hierbei um einen kausalen Zusammenhang handelt. Offenkundig ist, dass beide Erkrankungen das Herz-Kreislauf-System in Mitleidenschaft ziehen. Basismaßnahmen wie Rauchstopp, ausgewogene Ernährung und körperliche Bewegung wirken sich deswegen sowohl auf den Diabetes als auch bei COPD sehr positiv aus.
*Christopher Waxenegger ist Pharmazeut, Fach-Autor und Typ-1 Diabetiker.