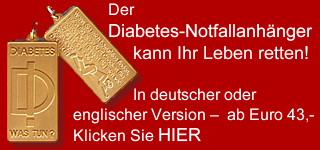Vier Antidiabetika im Vergleich: Was bei Typ-2-Diabetes nach Metformin verordnen?
Mit welchem Antidiabetikum als add-on zu Metformin lassen sich Blutzuckerziele bei Typ-2-Diabetes am ehesten erreichen? Eine von den US-National Institutes of Health geförderte Studie gibt Antworten.
(Rockville, 23.9.2022) - Metformin wird in fast allen Leitlinien als First-line-Therapie bei Typ-2-Diabetes empfohlen. Therapieziel ist dabei in der Regel ein HbA1c-Wert unter 7 Prozent. Wird dieses Ziel mit Basismaßnahmen plus Metformin nicht erreicht, dann wird die Therapie in den meisten Fällen durch Gabe eines weiteren Antidiabetikums eskaliert.
Zur Frage, welche Substanz dazu am besten geeignet ist, gab es bisher kaum Studiendaten. Das Defizit sollte mit der 2013 gestarteten GRADE-Studie behoben werden (das Akronym steht für „Glycemia Reduction Approaches in Type 2 Diabetes: A Comparative Effectiveness Study“). Verglichen wurden je ein Sulfonylharnstoff, Basalinsulin, GLP-1-Agonist und DPP4-Hemmer. Allerdings: Ein SGLT-2-Hemmer fehlt in dem Vergleich!
Die Studie wurde mit öffentlichen Mitteln finanziert, Sponsor war das National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) der National Institutes of Health (NIH). Die Gesamtergebnisse sind jetzt von der „GRADE Study Research Group“ im „New England Journal of Medicine“ publiziert worden (NEJM 2022: online 22. September).
Im Schnitt fünf Jahre Therapie ausgewertet
Für die Studie waren zwischen 2013 und 2017 in 36 US-Zentren 5047 Menschen mit Typ-2-Diabetes und maximaler Metformintherapie rekrutiert worden (mittlere Krankheitsdauer 4,2 Jahre, HbA1c im Schnitt 7,5 Prozent). Als add-on zu Metformin wurden sie nach dem Zufallsprinzip auf eins von vier häufig verwendeten Antidiabetika eingestellt: Glimepirid, Insulin glargin, Liraglutid oder Sitagliptin.
Mit der Medikation wurden sie im Schnitt fünf Jahre behandelt. Ermittelt wurde die kumulative Inzidenz eines HbA1-Wertes über 7,0 Prozentpunkte (primärer Endpunkt) als Zeichen, dass das HbA1-Ziel der Therapie nicht mehr erreicht wird. Die Ergebnisse:
- Bei 71 Prozent der Teilnehmenden insgesamt ließ sich mit der zusätzlichen Medikation der HbA1c in den fünf Jahren nicht oder nicht dauerhaft auf den Zielwert senken (HbA1 <7 Prozent).
- Es gab aber Unterschiede zwischen den Antidiabetika. Pro 100 Patienten und Jahr überschritten 26,1 Teilnehmende mit Liraglutid und 26,5 mit Insulin glargin den Zielwert. Bei Glimepirid waren es mit 30,4/100 und bei Sitagliptin mit 38,1/100 deutlich mehr.
- Je höher der HbA1c zu Studienbeginn war, desto mehr schienen die Patienten von Glargin, Liraglutid, Glimeperid im Vergleich zu Sitagliptin zu profitieren.
- Schwere Hypoglykämien waren selten, aber deutlich häufiger in der Glimepirid-Gruppe (2,2 Prozent der Patienten) im Vergleich zu Glargin (1,3 Prozent), Liraglutid (1,0 Prozent) oder Sitagliptin (0,7 Prozent).
Die Daten sollen Ärzte bei der Wahl einer antiglykämischen Substanz zur Therapieeskalation bei Typ-2-Diabetikern mit unzureichender Metformin-Therapie unterstützen. Allerdings: Die nephro- und kardioprotektive Wirksamkeit von GLP-1-Agonisten und SGLT-2-Hemmer (Gliflozine) waren zu Studienbeginn nicht bekannt und wurden nicht berücksichtigt. Diesen Substanzen wird heute bei Risikopatienten Vorrang in der Stufentherapie gegeben. Auch fehlen die Gliflozine in dem Vergleich.
Quelle: https://www.aerztezeitung.de/