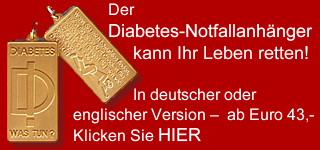Typ-2-Diabetes: Beim Ziel Diabetesremission gibt es nicht die eine Lösung für alle
Typ-2-Diabetes ist in manchen Fällen reversibel. Ob die Remission gelingt und was Patient und Arzt dafür tun müssen, hängt unter anderem davon ab, welcher Subtyp der Stoffwechselerkrankung genau vorliegt.
(2.6.2023) - Nicht alle Menschen mit neu manifestiertem Typ-2-Diabetes werden ihren Lebensstil ändern wollen“, sagte Dr. Johannes Scholl vom Praxisverbund Prevention First aus Rüdesheim am Rhein. „Aber diejenigen, die ihren Diabetes wieder loswerden wollen, haben ein Recht zu erfahren, wie das gehen könnte.“ Dazu aber sei die individuelle Beratung nach Subtypen zwingend erforderlich.
Dass die althergebrachte Einteilung in Typ-1- und Typ-2-Diabetes viel zu unpräzise ist, war schon länger klar. Ein detaillierteres Modell hatte eine schwedische Arbeitsgruppe 2018 vorgeschlagen, berichtete der Referent. Anhand der Daten von fast 9.000 Patienten, die als Erwachsene neu an Diabetes vom Typ 2 erkrankt waren, hatten die Wissenschaftler fünf praxisrelevante Cluster gebildet:
Cluster 1: 6–7 % der Betroffenen wiesen einen schweren autoimmun bedingten Diabetes (SAID) auf, der dem bisherigen Typ 1 oder LADA entspricht.
Cluster 2: Bei 15–20 % lag eine angeborene Störung der schnellen Insulinausschüttung (SIDD) vor, mit hohem Risiko für KHK und Niereninsuffizienz.
Cluster 3: Ca. 15 % hatten eine genetisch bedingte schwere Insulinresistenz (SIRD), meist mit Familienanamnese für Typ-2-Diabetes. Oft waren die Betroffenen schon als Kind adipös; sehr hohes Risiko für KHK und Niereninsuffizienz.
Cluster 4: Rund 20 % zeigten moderate bis starke Insulinresistenz (MOD) bei einem BMI ≥ 35, oft mit MAFLD*, Fehlernährung und Bewegungsmangel.
Cluster 5: Bei 35–40 % fand sich eine leichte bis moderate Insulinresistenz (MARD). Alter > 70 Jahre, oft Sarkopenie, Bauchfettzunahme, hohes KHK-Risiko. Lediglich leichter bis moderater altersbedingter Diabetes bei nur mäßig verändertem Stoffwechsel.
Diese fünf Typen unterscheiden sich nicht nur in der Ursache der Erkrankung, sondern auch darin, auf welche Therapie der Patient am besten anspricht, erklärte Dr. Scholl.