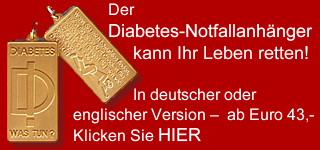Ketonmonitoring: „Der Airbag für die Diabetestherapie“
Sehr seltene schwere Stoffwechselentgleisungen mit potenziell tödlichen Folgen ließen sich mit kontinuierlicher Ketonmessung (CKM) verhindern. Dazu werden CGM-Systeme mit zusätzlichem Sensor für die Ketonmessung entwickelt.
(Deutschland, 6.4.2023) - Nach Auffassung mancher Diabetologen sollte das kontinuierliche Glukosemonitoring (CGM) zumindest bei Risikopatienten um ein Ketonmonitoring ergänzt werden. „Ein kontinuierliches Ketonmonitoring ist so etwas wie der Airbag im Auto: Wird selten benötigt, kann aber Leben retten“, sagte Professor Christophe De Block vom Universitätshospital Antwerpen bei der internationalen Konferenz ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) in Berlin.
Ketone entstehen bei Insulinmangel, Hunger, unzureichender Kohlenhydratzufuhr oder vermehrtem Alkoholkonsum. Die Prävalenz diabetischer Ketoazidosen (DKA) liegt bei Typ-1-Diabetes (T1D) in Industrieländern zwischen 10 und 130/1.000 (J Diabetes Sci Technol 2022; 16(3): 689–715).
Risiko bei anstrengender Bewegung oder zu wenig Insulin
Ketonkörper treten bei Menschen mit Diabetes vor allem bei inadäquater Insulindosierung auf, bei starker körperlicher Belastung oder wenn Gewicht reduziert werden soll. Vor Operationen wird wegen befürchteter Hypoglykämien ebenfalls teils unzureichend Insulin appliziert, auch postoperativ kommen Ketoazidosen vor, etwa nach bariatrischer Chirurgie.
Ein weiteres Risiko: SGLT2-Inhibitoren (SGLT2i) könnten bei T1D künftig wahrscheinlich vermehrt eingesetzt werden, weil sie zu einer verbesserten Glukosestoffwechsellage beitragen und den damit Behandelten kardiorenale Vorteile bieten. Allerdings liegt die DKA-Prävalenz bei Patienten mit T1D, die SGLT2-Inhibitoren einnehmen, bei 1,5 bis 3,0 Prozent, erklärte De Block.
Bei Verwendung von Closed-loop-Systemen kann es unter SGLT2i-Therapie zur DKA kommen, weil die automatische Insulinversorgung auf Dosen herunterreguliert wird, die unter dem Minimum liegen, das zur Verhinderung der Ketonbildung erforderlich ist. Allerdings: Aktuell gibt es in Deutschland keinen bei T1D zugelassenen SGLT2i mehr.
Nur wenige Patienten überprüfen Ketonbelastung
Hauptproblem gegenwärtiger Keton-Testmethoden ist, dass damit die DKA erst detektiert wird, wenn sie bereits da ist. Außerdem prüfen nur wenige Patienten mit T1D ihre Ketonkörperbelastung, sei es aus Kostengründen, weil sie keine Keton-Teststreifen vorrätig haben, den Test als unnötig erachten oder mit der Information nichts anfangen können.
Inzwischen befinden sich Sensoren zum kontinuierlichen Ketonmonitoring (CKM) in der klinischen Entwicklung, die bis zu 14 Tage genaue Werte messen können. De Block stellte Daten einer neuen Echtzeit-CKM-Mikronadel-Plattform vor, die darauf basiert, Glukose und beta-Hydroxybutyrat (BHB) als wichtigsten Ketonkörper elektrochemisch zu überwachen.
Hinweise bei Gefährdung nötig
In einer anderen Machbarkeitsstudie war bei Probanden mit T1D und Gesunden ein münzgroßer Multimetaboliten-Sensor für die Nahinfrarot-Spektroskopie für 28 Tage implantiert worden. Damit konnte ein breiter Bereich von Glukose- und Ketonspiegeln mit akzeptabler Genauigkeit bestimmt werden. Sechs von sieben implantierten Sensoren blieben während des gesamten Studienzeitraums voll funktionsfähig.
„Brauchen wir ein kontinuierliches Ketonmonitoring? Ja! Brauchen wir die kontinuierliche Ketonanzeige? Nein!“, lautete De Blocks Fazit. Es reiche ein Hinweis, wenn Ketonspiegel in einen kritischen Bereich gelangen, sodass rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Dafür werden künftig entsprechende Software-Algorithmen in CGM- und AID (Automated Insulin Delivery)-Geräten benötigt.
Quelle: https://www.aerztezeitung.de/