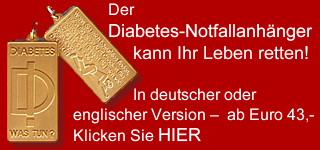Gewichtsdiskriminierung: Mehr Sensibilität für eine bessere Gesundheit
Menschen mit Übergewicht sind oftmals Stigmatisierung ausgesetzt – auch in Arztpraxen. Solche Erfahrungen können die Gesundheit verschlechtern und zu einer weiteren Gewichtszunahme führen. Das sollte in der medizinischen Behandlung verhindert werden.
(Deutschland, 28.4.2023) - Sie müssen abnehmen. Das ist vermutlich ein Satz, den Menschen mit Übergewicht oft von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin gehört haben. Allerdings hilft er nicht unbedingt beim Gewichtsverlust. Vor allem dann nicht, wenn man eigentlich wegen eines Schnupfens ärztliche Hilfe aufsucht. „Viele dicke Menschen berichten, dass ihre Beschwerden pauschal mit ihrem Gewicht in Zusammenhang gebracht werden“, sagt Dr. phil. Friedrich Schorb vom Institut für Public Health der Universität Bremen. Der Soziologe forscht unter anderem speziell zum Thema Gewichtsdiskriminierung.
Die Folgen reichten von der nicht entdeckten Schilddrüsenunterfunktion bis zur über Monate hinweg als Diabetes behandelten unerkannten Schwangerschaft, so Schorb. „Die Vorstellung, hochgewichtige Menschen könnten ein aktives Sexleben haben, scheint für viele Ärztinnen und Ärzte offensichtlich abwegig oder es wird davon ausgegangen, dass sich bei hohem Gewicht automatisch Unfruchtbarkeit einstellt.“
Schorb rät zu Offenheit mit dem Thema. Um eine ergebnisoffene Untersuchung zu gewährleisten, sollte die pauschale Annahme vermieden werden, dass alle Beschwerden auf das Gewicht zurückzuführen sind. (DÄ).
Auch wenn das Körpergewicht für viele Erkrankungen eine nicht unerhebliche Rolle spielt, sollte man sich im therapeutischen Gespräch zunächst auf die Auswirkungen des Übergewichts, also die Beschwerden, die dadurch entstehen, fokussieren, sagt Dr. med. Veronika Hollenrieder dem Deutschen Ärzteblatt. In ihrer Münchner Praxis legt sie deshalb zunächst den Schwerpunkt auf die zu behandelnden Grunderkrankungen, wie etwa Diabetes, Bluthochdruck oder Gelenkbeschwerden. „Wir erklären den Patienten, wie hilfreich es ist, im Rahmen der Behandlung das Ernährungs- und Bewegungsverhalten zu verändern.“ Sie spreche also zunächst nicht das Übergewicht an. „Zu einem dicken Menschen zu sagen, er müsse abnehmen, ist der schlimmste Satz, den man als Arzt oder Ärztin überhaupt sagen kann“, so Hollenrieder. Denn das wüssten dicke Menschen selbst und es stelle eine Diskriminierung dar. Gleich zu Beginn eines Gesprächs werde die Arzt-Patienten-Kommunikation dadurch zerstört.
Diskriminierung erhöht Gewicht
Oftmals würde den Patientinnen und Patienten die Schuld für ihr Übergewicht zugeschoben: „Natürlich haben sie Diabetes, weil Sie ja zu dick sind“, sind Sätze, die Patientinnen und Patienten Hollenrieder zufolge oft zu hören bekämen. „Wir sollten dicken Menschen Gesundheit anbieten und keine Schuldzuweisungen machen.“
Das allerdings tut ein Drittel der Deutschen Bevölkerung, wie aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage der DAK aus dem Jahr 2016 hervorgeht (1). Doch Schuldzuweisungen und Vorurteile führen oftmals dazu, dass dicke Menschen weiter an Gewicht zunehmen. So zeigt beispielsweise eine Studie mit knapp 1 400 Teilnehmenden in sechs verschiedenen Ländern, darunter auch Deutschland, den Zusammenhang zwischen verinnerlichten Gewichtsvorurteilen und der Gewichtszunahme (2). Wenn sich Menschen diskriminiert fühlten, nahmen sie eher an Gewicht zu. Zusätzlich war die Diskriminierung mit einer schlechteren Lebensqualität verbunden, die Kontrolle über das Ess- und Bewegungsverhalten nahm ab und die Menschen vermieden es, ins Fitnessstudio zu gehen.
Die Stigmatisierung ist Hollenrieder zufolge ein Grund, weshalb dicke Menschen oftmals Arztbesuche vermieden. Hinzu kämen die räumlichen Gegebenheiten. „Dicke Menschen können sich in einer Arztpraxis nicht in einen Stuhl mit einer Rundumlehne setzen“, erklärt die Internistin. Sie selbst habe daher bewusst andere Stühle.
Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung (GgG) warnt vor einer zu starken Gewichtsfokussierung im medizinischen Kontext: „Wir machen in unserer Arbeit immer wieder die Erfahrung, dass eine Fokussierung auf das Körpergewicht auf lange Sicht weder dauerhaft den dünnen Körper herstellt noch zur Gesundheit hochgewichtiger Menschen beiträgt – eher im Gegenteil.“ Die GgG setze sich unter anderem dafür ein, dass „Körpergewicht“ als Diskriminierungsdimension in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes aufgenommen wird. Zusätzlich müsse ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, wie Menschen auf Körper blicken und mit ihnen umgehen: „Wir müssen die Gleichwertigkeit aller Körper verinnerlichen und dass die Menschenwürde bedingungslos gilt“, sagt Rosenke. Hochgewichtige Menschen hätten im Umgang den gleichen Bedarf wie wohl fast alle Personen, die in eine Praxis kämen: Sie wünschten sich eine respektvolle, empathische Ansprache auf Augenhöhe, eine unvoreingenommene Ursachenforschung hinsichtlich ihrer Beschwerden und dass ihnen alle Therapiemöglichkeiten vorgestellt würden. „Sie wollen selbst entscheiden, welche für sie gangbar sind und welche nicht.“
Die GgG fordert mehr medizinische Versorgung auf der Basis des „Health at every Size“-Prinzips. Dabei soll der Fokus der Gesundheit nicht auf dem Gewicht, sondern auf einer insgesamt gesunden Lebensweise liegen. „Das wäre ein inklusiver Ansatz, mit dem viele Diskriminierungserfahrungen entfallen würden, die hochgewichtige Menschen im Bereich Gesundheit, Prävention und Pflege machen“, erklärt Rosenke.
Behandlung mit Einverständnis
Die Stigmatisierung dicker Menschen sei im Gesundheitswesen auch strukturell bedingt, wie die Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG) berichtet: „Während Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen selbstverständlich Zugang zu einer Vielzahl an Behandlungsangeboten haben, ist dies bei Adipositas nicht der Fall.“ Die meisten Bausteine der Adipositasbehandlung seien keine Regelleistung, sondern müssten durch die Betroffen selbst gezahlt oder bezuschusst werden, sagt ein Sprecher der DAG. Für den hausärztlichen Kontext sollte das 5A-Modell nach Meinung der DAG eine stärkere Verbreitung finden (Kasten). Demnach ist es sinnvoll, wenn Ärztinnen und Ärzte zunächst nach Erlaubnis fragen, ob ein Patient oder eine Patientin über das Gewicht sprechen will.
Der Internistin Hollenrieder zufolge muss die Prävention viel früher beginnen. „Übergewicht steht häufig in Verbindung mit einer Depression, Angst- oder Suchterkrankung. Deshalb sind vielfach auch psychosoziale Unterstützungsangebote erforderlich. Wir machen teure Präventionsmedizin, aber wir holen dicke Menschen zu spät ab.“
1. | forsa Politik- und Sozialforschung GmbH: XXL-Report: So werden dicke Menschen ausgegrenzt; DAK Gesundheit 2016 https://www.dak.de/dak/download/forsa-studie-xxl-report-2116468.pdf (last accessed on 21 April 2023). |
2. | Pearl RL, Puhl RM, Lessard LM, et al.: Prevalence and correlates of weight bias internalization in weight management: A multinational study. SSM Popul Health 2021; 13: 100755. CrossRefMEDLINEPubMed Central |