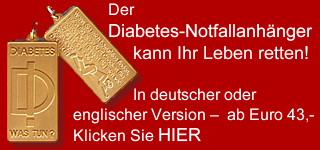„Das Herz-Risiko lässt sich deutlich senken
Spitzen-Diabetologe Michael Nauck im Interview
Es gibt viele neue Therapie-Tools, im Gegensatz zu früher stehen insgesamt und in Kombinationen 40 Medikamente zur Verfügung, und neue Software verspricht Diabetikern mehr und sichere Unterstützung im Alltag. Was ist Ihre persönliche Conclusio dessen, was wir auf dem heurigen Diabetes-Kongress EASD in Lissabon erfahren haben?

Prof. Dr. Michael Nauck : Ich besuche die europäischen Diabeteskongresse schon seit ungefähr 35 Jahren und betrachte die Ergebnisse immer sehr genau. Die diesmal präsentierten kardiovaskulären Outcome-Studien sind wirklich absolute Highlights, die tatsächlich in der Lage sind, die klinische Praxis massiv zu ändern, weil man – je nach Erkenntnislage – Patienten einen solchen Vorteil ja gar nicht vorenthalten kann.
Was konkret bringen die neuen Erkenntnisse?
Prof. Michael Nauck:Von den Zahlen her ist ja schon lange bekannt, dass ein Mensch mit Diabetes – selbst wenn er noch nie einen Kardiologen aufsuchen musste – ein deutlich erhöhtes Risiko hat, im kommenden Leben Herzinfarkte oder kardiovaskulär bedingte Todesfälle zu erleben. Ebenso, dass dieses Risiko sogar so hoch ist wie bei einem nicht-diabetischen Menschen, der bereits einen Herzinfarkt erlitten hat. Dies ist ja die typische Hochrisiko-Konstellation, bei der wir sekundär-präventive Maßnahmen vorschlagen.
Da gibt es also Menschen mit Typ 2 Diabetes, die noch kein kardiovaskuläres Ereignis und noch keine entsprechende Diagnose gehabt haben. Und sie haben ein etwa zweieinhalbfach erhöhtes Risiko, an kardiovaskulären Ursachen zu sterben.
Hat jemand Diabetes UND eine Herzdiagnose, steigt diese Gefahr im Vergleich zur nicht-diabetischen Bevölkerung wahrscheinlich noch auf das Vierfache. Wir haben sehr lang bekannte Mittel, die hier helfen können: Man kann schätzen, dass das Normalisieren des LDL-Cholesterins mit einem Statin oder mit anderen Medikamenten etwa ein Drittel des Risikos senken kann. Den Blutdruck einzustellen und helfende Herzmedikamente einzunehmen bringt vielleicht nochmals 20 Prozent Gefahrenreduktion.
Was allerdings die Todesfälle durch kardiovaskuläre Erkrankungen angeht, sagen alle zusammenfassenden Studien leider, dass eine gute Diabetes-Einstellung da recht wenig ausrichtet, sofern sie mit konventionellen Medikamenten durchgeführt wurde – also mit Insulin und oralen Anti-Diabetika.
Doch jetzt haben wir seit zwei Jahren Evidenz, dass zwei neue Medikamentenklassen mehr Erfolg erzielen. Das sind einerseits die GLP1-Rezeptor-Agonisten – jedoch mit einer gewissen Heterogenität. Von den heute zur Verfügung stehenden Mitteln ist es ausschließlich das Liraglutid, das in der so genannten Leader-Studie kardiovaskuläre Ereignisse verhindert hat. Immerhin: Auch wenn man die kardiovaskulären Todesfälle für sich betrachtet, konnten hier 15 Prozent Reduktion nachgewiesen werden. Und es wirkt sich ebenfalls auf die Gesamtsterblichkeit aus, die ebenfalls signifikant um 13 Prozent gesenkt werden konnte.
Das andere Medikament ist Empagliflozin, das erste in der Klasse der SGLT2-Hemmer. Dieses hat in Bezug auf die kardiovaskulären Todesfälle sogar noch weitergehende Verbesserungen gezeigt. In Zahlen betrachtet höher, allerdings nicht direkt vergleichbar, weil in unterschiedlichen Studien und Patientenpopulationen erhoben.
Deswegen kann man heute sagen, dass man durch Einsatz all der genannten Tools vom sehr, sehr stark erhöhten Risiko herunterkann, mit dem viele Typ-2-Patienten bisher leben mussten. Man erreicht jedoch nach wie vor nicht das Risiko-Niveau, das für nicht-diabetische Menschen typisch ist. Das heißt, dass wir an unseren Werkzeugen noch arbeiten, diese optimieren oder besser kombinieren müssen, als wir das bisher getan haben.
Werden diese Erkenntnisse ab sofort allen Diabetikern weiterhelfen?
Prof. Michael Nauck:Wir müssen ganz sicher auch noch dafür sorgen, dass die Mittel, die wir zur Verfügung haben – im Gegensatz zur jetzigen Situation in der Patientenversorgung – auch zur Anwendung kommen.
In vielen Fällen gibt es regional und national unterschiedliche Regeln, die darauf abzielen, die Kosten im Gesundheitssystem unter Kontrolle zu halten. Zum Teil behindern derlei Regeln die nutzbringende Anwendung dieser Therapien für Patienten regelrecht. Das ist natürlich ein sehr trauriger Tatbestand, weil es grade diese Patienten natürlich verdienen, alle Mittel zu bekommen, die ihnen tatsächlich eine bessere Lebensprognose geben.
Gibt es aus Ihrer Sicht weitere aktuelle Highlights?
Prof. Michael Nauck:Ich habe auch Freude an den kleinen Fortschritten, die es überall gibt, und für die man nicht gleich die Leitlinien umschreiben muss. Da gibt es in der Tat in vielerlei Hinsicht Verbesserungen.
Das ist zum Teil die Optimierung der Medikamente: Die gleichen Klassen, die aber in Bezug auf manche Outcomes eben noch wirksamer werden.
Das sind aber auch technische Änderungen wie – wenn man jetzt den Typ-1-Diabetes auch mit einbezieht – Insulinpumpen, die in Zusammenarbeit mit kontinuierlicher Glukosemessung allerlei können. Der erste und kleinste Schritt ist, dass die Insulingabe im Fall einer Hypoglykämie abgeschaltet wird. Das hat sich als extrem hilfreich erwiesen.
Man versucht jetzt natürlich, eine noch engere Kopplung zu erreichen, damit die Insulinabgabe ganz durch die Messwerte der Glukose gesteuert wird. Das funktioniert schon ganz gut, so lange die Patienten nicht essen. Aber der Zuckeranstieg ist nun einmal kein ausreichendes Erkennungssignal dafür, wann eine große Mahlzeit gegessen wurde. Hier muss man schon noch zusätzliche Informationen in das System einbringen, damit es einigermaßen funktioniert.
Und welche neuen Medikamentenentwicklungen sind derzeit besonders interessant?
Prof. Michael Nauck:Hier sind, meine ich, momentan jene besonders aufregend, die versuchen, das zu ersetzen, was derzeit die Bariatrische Chirurgie für Gewichtsabnahme, aber auch quasi für eine Heilung von Diabetes leistet.
Es wird daran gearbeitet, den aus dem Darm freigesetzten Hormonmix, der ausschlaggebend zu sein scheint, medikamentös zu imitieren. Im Tierversuch gelingt das bereits. Hier schafft man es inzwischen, dass Tiere durch ein solches Medikament bis zu 25 Prozent ihres Körpergewichts abbauen.
Der Weg zum Menschen ist jedoch sicher noch weit, weil es sich um sehr komplexe Medikamente handelt und Menschen etwas anders reagieren als Tiere. Der Weg ist allerdings vorgezeichnet: Ich könnte mir vorstellen, dass die bariatrische Chirurgie in zehn bis 15 Jahren durch entsprechend wirksame Medikamente abgelöst wird.
Was halten Sie von den Fortschritten in Sachen Software-Tools?
Prof. Michael Nauck: Was neue Software-Lösungen betrifft, ist da sicherlich Potenzial gegeben. Ich erkenne jedoch noch keine manifesten Programme, denen ich hier wirklich viel zutrauen würde.
Denn: Viele Daten irgendwohin zu schicken ist nicht schwer. Daran, diese Daten in einer wirklich hilfreichen Struktur anzubieten, die es etwa einem Arzt ermöglicht, schnell gute Ratschläge zu geben, oder die erhaltenen Informationen überhaupt aufzulösen, sollten wir aber noch arbeiten.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler solcher Software sich gerne unmittelbar an die betroffenen Patienten wenden. Mir wäre es lieber, wenn es sich dann doch um integrierte Konzepte handeln würde, bei denen sowohl die ärztliche als auch die diabetesberater-bedingte Betreuung miteinbezogen wird.
Denn wenn das allzu autonom und neben der üblichen Gesundheitsversorgung abläuft, können auch Gefahren damit verbunden sein. Ich hoffe hier sehr auf integriertes Vorgehen – und darauf, dass alle, die mithelfen können, auch einbezogen werden, damit man im Einverständnis voranmarschiert. Denn dann könnten daraus sicher sehr hilfreiche Ergänzungen zu unserem heutigen Angebot werden.

Zur Person Prof. Dr. med. Dr. med. h.c. Michael Albrecht Nauck
Curriculum vitae
(einschließlich klinischem und wissenschaftlichem Werdegang)
Geboren 08.12.1954 in Tübingen (Vater: Joachim Nauck, Ingenieur; Mutter: Gundela Nauck, geborene Beyer, Erzieherin und Lehrerin).
Seit 08.12.1986 verheiratet mit Dr. med. Corinna Nauck, geb. Niederkleine.
Am 22.11.1987 wurde unsere Tochter Anna Lena geboren, die seit ihrer Geburt behindert ist.
Schulbesuch in Köln, Remscheid-Lennep und Düsseldorf (Abitur 1973 am Leibniz-Gymnasium, Düsseldorf).
Studium (Medizin)Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (WS 73/74 - WS 74/75) und Universität Freiburg (SS 75 - SS 80).
Innerhalb dieser Zeit ein Jahr als "Graduate Student" im Fach Onkologie an den McArdle Laboratories for Cancer Research, University of Wisconsin, Madison, USA (Arbeitsgruppe Prof. Dr. H. Pitot; WS 76/77 u. SS 77).
Praktisches Jahr am Städtischen Klinikum Karlsruhe (Innere Medizin: Prof. Dr. E. Zeh; Neurologie/Psychiatrie: Prof. Dr. N. Müller; Chirurgie: Prof. Dr. K. Spohn).
Staatsexamen 10/1980; Approbation als Arzt 12/1980; Visa Qualifying Examination (ECFMG) 6/1980.
Dissertationsthema:Modulation der Glucagon-abhängigen Induktion der Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase durch physiologische Sauerstoffkonzentrationen in Hepatocytenkulturen (Entstanden im Biochemischen Institut Freiburg/Göttingen in der Abteilung von Prof. Dr. K. Jungermann).
Berufliche Weiterbildung: 1-5/1981 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Biochemie (Abt. Prof. Dr. K. Jungermann).
Seit 6/1981 in der Abteilung Gastroenterologie und Endokrinologie des Zentrums Innere Medizin (Vorsteher: Prof. Dr. med. W. Creutzfeldt) der Georg-August-Universität Göttingen (zunächst Zivildienst 6/81 bis 10/82, später ab 11/82 wissenschaftl. Mitarbeiter, Akademischer Rat auf Zeit, 10/88 bis 4/93 Hochschulassistent C1).
In dieser Zeit: Allgemeinstation Innere Medizin 32 Monate; Infektionsstation: 21 Monate; Intensivstation: 11 Monate; Röntgendiagnostik: 6 Monate; Poliklinik (allgemeine Innere Medizin) 18 Monate; Endoskopie: 17 Monate ganztags, davon 8 Monate ERCP/PTC/Laparoskopie; gastroenterologische-, Leber- und endokrinologische Sprechstunden. Von 1981 bis 1992 Teilnahme an klinischen Prüfungen von pharmazeutischen Wirkstoffen oder Medikamenten.
5/93 Oberarzt, seit 2 /96 bis 9/99 Leitender Oberarzt und Chefarztstellvertreter der Medizinischen Universitätsklinik der Ruhr-Universität, Knappschafts-Krankenhaus Bochum (Direktor: Prof. Dr. W. Schmiegel). In dieser Zeit: Schwerpunktstation Gastroenterologie/Hepatologie 24 Monate; Allgemeine Innere Medizin/Kardiologie 12 Monate; Diabetologie/Endokrinologie 27 Monate; Intensivstation Innere Medizin 12 Monate. Spezialambulanz (Hepatologie, Diabeologie, Endokrinologie). Betreuung von Patienten mit Diabetes (Ernährungsberatung, Schulung usw.). Von 1993 bis 1999 Teilnahme an klinischen Prüfungen von pharmazeutischen Wirkstoffen oder Medikamenten.
10/99 bis 4/2000 Projektleiter Klinische Studien an der Medizinischen Klinik 1, St. Josef-Hospital, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum (Direktor Prof. Dr. W. Schmidt); in dieser Zeit: Durchführung klinischer Studien zu GLP-1-Effekten (bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt, unter parenteraler Ernährung etc.). Teilnahme an klinischen Prüfungen von pharmazeutischen Wirkstoffen oder Medikamenten.
Seit 5/2000 Einarbeitung, seit 11/2000 Leitender Arzt des Diabeteszentrum Bad Lauterberg (Fachklinik für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten). Teilnahme an klinischen Prüfungen von pharmazeutischen Wirkstoffen oder Medikamenten, zum Teil als Prüfleiter („Principal Investigator“).
Seit 1.1.2015 Leiter der Klinischen Forschung an der Abteilung für Diabetologie (Ltd. Arzt: Prof. Dr. med. Juris J. Meier), Medizinische Klinik 1 (Direktor Prof. Dr. W. Schmidt), St. Josef-Hospital, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum.
Facharztanerkennungen/Zusatzbezeichnungen:3/1991 Anerkennung als Arzt für Innere Medizin; 1/93 Zusatzbezeichnung (Schwerpunkt) Gastroenterologie. 7/1996 Zusatzbezeichnung (Schwerpunkt) Endokrinologie. 1/1996 Fachkunde Internistische Intensivmedizin, Fachkunde Koloskopie/Sigmoideoskopie, Fachkunde Internistische Röntgendiagnostik, Fachkunde Laboratoriumsmedizin, Diabetology (Diabetologe DDG).
Wissenschaftliche Interessengebiete (siehe Verzeichnis der Veröffentlichungen):
(a) Die Bedeutung gastrointestinaler Peptidhormone für die physiologische und möglicherweise therapeutische Stimulation der Insulinsekretion.
(b) Pathophysiologie des denervierten menschlichen Pankreas (exokrine und endokrine Funktion bei Pankreas-transplantierten Patienten) - Zusammenarbeit mit der Chirurgischen Universitätsklinik Tübingen, später Rostock, jetzt Freiburg, Arbeitsgruppe um Prof. Dr. U.T. Hopt und Prof. Dr. M. Büsing, Bochum, jetzt Recklinghausen.
(c) Diagnostische Verfahren zum Nachweis einer autonomen Insulinsekretion bei Insulinompatienten.
(d) Stoffwechselversuche zur Quantifizierung der Insulinsekretion und -wirkung beim Menschen.
(e) Bedeutung der Stoffwechselkontrolle und antidiabetischen Medikation auf das Überleben von Patienten mit Typ 2-Diabetes und akutem Myokardinfarkt
Habilitation an der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen: 7/92 (Thema: Die Bedeutung zirkulierender Konzentrationen von Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP), Glucagon-like Peptide 1 [7-36 Amid] (GLP-1) und Cholecystokinin (CCK) sowie der extrinsischen Pankreasinnervation für die Insulinsekretion beim Menschen).
Umhabilitation an die Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum: 6/1995.
Ernennung zum apl. Professor an die Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum: 7/1998.
Umhabilitation an die Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen: 4/2004.
Drittmittelförderung durch DFG, Bonn-Bad-Godesberg; Wilhelm-Sander-Stiftung, München; B. Braun-Stiftung, Melsungen; Projektförderungen durch Novo-Nordisk, Kopenhagen, Dänemark; Eli Lilly & Co. Deutschland/USA; Sanofi (former Sanofi-Aventis, Hoechst-Marion-Roussel) Bad Homburg; Restoragen (ehemals BioNebraska), Lincoln, Nebraska /USA; Merck, Sharp & Dohme, München; Fa. Sanofi (ehemals Sanofi-Aventis, Hoechst-Marion-Roussel), Bad Homburg; Novartis Pharma, Bern, Schweiz; Roche, Basel, Schweiz; Amylin, San Diego, USA; und die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG).
Preisverleihungen:Anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft 1993 erhielt ich den Ferdinand-Bertram-Preis und 2007, den Werner-Creutzfeldt-Preis der DDG (Deutsche Diabetes-Gesellschaft), sowie 2012 die Paul-Langerhans-Medaille der DDG. 2016 Ehrendoktorwürde der Universität Kopenhagen.
Mitgliedschaften:
Deutsche Diabetes-Gesellschaft s. 1984
Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten s. 1985
European Society for the Study of Diabetes s. 1985
Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie s.1990
Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin s. 1992
International Diabetes Federation s. 1992
American Diabetes Association s. 1994
Publikationen: (Publikationsliste)
170 Originalarbeiten, 99 Reviews und 39 Buchartikel,
> 350 veröffentlichte Vorträge/Poster/Abstracts.
Herausgeber und Chefredakteur: Supplement Band Z Gastroenterologie: Sekundärer Diabetes bei gastroenterologischen Erkrankungen (mit Prof. Dr. U.T. Hopt)
Diabetes-Newsletter(2000-2010)
Mitherausgeber:Diabetes und Stoffwechsel (1998-2002)
Mitherausgeber (Associate Editor): Diabetes (Juli 2006-Ende 2011)
Gutachtertätigkeit für folgende Zeitschriften:
Am J Physiol, Clin Science, Diab Research Clin Pract, Digestion, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologia, Diabetes Stoffw, Diabetes Obesity Metab, Diabetic Med, Diabetologia, Diabetologie Stoffw, Endocr Rev, Endocrinol, Eur J Clin Invest, Exptl Clin Endocrinol Diabetes, Horm Metab Res, J Mol Endocr, J Diabetes Compl, J Biol Chem, J Clin Endocrinol Metab, J Clin Invest, The Lancet, The Lancet Endocrinology/Diabetes, Life Sci, Nature Medicine, Nature Reviews Endocrinology/Diabetes, N Engl J Med, Obesity Research, Regul Pept, Z Gastroenterol.
Besondere Aufgaben:
NDG: Ausrichtung der Jahrestagung 2003
DDG: Schriftführer des Vorstandes (2001-2005)
Kommission Klinische Studien (2003-2009)
Tagungspräsident 2010 (Vorstand 2008-2010)
Mitglied der Jury zur Förderung wissenschaftlicher Projekte (2008-heute, seit 2011 Vorsitz)
Mitwirkung an Leitlinien zur anti-hyperglykämischen Therapie des Typ 2-Diabetes
EASD: Panel Overseeing Statements and Guidelines (2009-2013)
EASD Writing Group “Position Statement on the Anti-Hyperglycaemic Treatment of
Type 2-Diabetes” (2010-heute)
Freizeitaktivitäten:Klavierspiel, Kammermusik (aktiv und passiv), Sport (Joggen, Tennis, Radfahren, Schwimmen), Lesen (z.B. antiquarische Diabetes-Literatur)