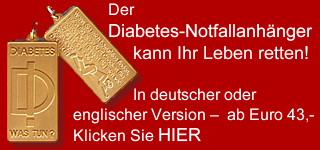Chronische Nierenkrankheit bei Diabetes früh identifizieren
Wer eine chronische Nierenkrankheit bei Diabetes früh identifizieren möchte, sollte konsequent den Urin regelmäßig auf Albumin screenen, empfehlen Nephrologen.
(6.9.2022) - Gegen diabetesbedingte Nierenschäden bei Typ-2-Diabetes gibt es heute effektive medikamentöse Therapien. Deshalb ist es so wichtig, die Nierenfunktion bei Menschen mit Diabetes im Blick zu behalten. Dies sollte jedoch mit den richtigen Diagnose-Instrumenten erfolgen: Eine chronische Nierenkrankheit (CKD) wird nur dann rechtzeitig erkannt, wenn konsequent nach Albumin im Urin gesucht wird.
Der Nephrologe Professor Christoph Wanner aus Würzburg hat beim Internistenkongress 2022 eindringlich dafür geworben, einmal im Jahr die Albumin-Kreatinin-Ratio zu bestimmen, und zwar aus dem morgendlichen Spontanurin. Denn der Blick allein auf die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) reiche nicht aus, so Wanner: „In dem Bereich, wo die meisten Patienten liegen, ist ohne Albumin keine Erkennung der CKD möglich.“
Auch im Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2022 wird beklagt, dass die international empfohlene Bestimmung der Albumin-Konzentration im Urin nicht flächendeckend umgesetzt werde. Die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR) gilt als guter Parameter für die endotheliale Dysfunktion (auch) der Nierengefäße. Sie muss aber unabhängig von der eGFR betrachtet werden, da es bei Typ-2-Diabetes auch eine CKD noch ohne Albuminurie geben kann.
Mikroalbuminurie-Test ungeeignet
Wanner verwies auf Umfragen unter Fach- und Allgemeinärzten, wonach nur eine Minderheit von ihnen die UACR bestimmt, häufig werde auf den zu wenig sensitiven Mikroalbuminurie-Test gesetzt. Hintergrund: Konzentrationsangaben aus dem Urin sind nur bedingt aussagekräftig, weil die Konzentration in Abhängigkeit von der Trinkmenge schwanken kann.
Im Vergleich zum möglichen 24-Stunden-Sammelurin, um diesen Effekt auszugleichen, ist die Berechnung des UACR die praktikablere Screening-Variante. Die Albuminkonzentration wird dabei nicht auf das Urinvolumen bezogen, sondern auf die Kreatinin-Konzentration in derselben Urinprobe. Die Kreatinin-Konzentration korreliert relativ zuverlässig mit der Konzentriertheit des Urins.
Dass sich die Progression einer CKD mit SGLT2-Hemmern aufhalten lässt, hat sich inzwischen herumgesprochen. Es wird erwartet, dass sich die Studienlage Ende 2022 noch einmal verbreitert, etwa was Patienten mit einer eGFR von 25 bis 45 ml/min und ohne erhöhte UACR angeht.
In der in diesem Jahr aktualisierten und noch im Review befindlichen Leitlinie der Organisation KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcome) wird nach Wanners Angaben Diabetes-Patienten mit CKD die Behandlung mit einem SGLT2-Hemmer in Kombination mit Metformin ohne Einschränkungen als Therapie der ersten Wahl empfohlen werden, und zwar bei jedem Patienten mit einer eGFR von mindestens 20 ml/min. Die Metformin-Dosis soll ab einer eGFR von 45 ml/min reduziert werden, unter 30 ml/min soll Metformin abgesetzt werden.
Für Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD, die mit Metformin und SGLT2-Hemmern nicht ihre individuellen Stoffwechselziele erreichen oder diese Wirkstoffe nicht einnehmen können, werden GLP-1-Rezeptoragonisten als wichtiger Teil der medikamentösen Therapie empfohlen, bei Hypertension außerdem die RAS-Blockade mit ACE-Inhibitoren oder Angiotensin-II-Rezeptorblockern.
Nummer 1 und 2 der Top-10-Hinweise der KDIGO für Ärzte benennen jedoch als wichtige Basismaßnahmen, die unbedingt an die betroffenen Patienten weitergegeben werden müssen: gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und Rauchstopp.
Rauchen sei unbedingt einzustellen, „da es gesicherte Erkenntnisse hinsichtlich der Schädigung der Nierenfunktion gibt, die über die weithin bekannten gesundheitlichen Schäden durch das Rauchen weit hinausgehen“, schreibt Dr. Ludwig Merker aus Erkrath im Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2022. Weiterhin sollten sich die Patienten an möglichst fünf Tagen der Woche jeweils eine halbe Stunde lang gesundheitsfördernd belasten, so Erkrath. Das entspricht einer mittleren körperlichen Anstrengung.
Fundierte Ernährungsberatung!
Was die Ernährung angeht, soll die Eiweißzufuhr normalisiert werden, internationaler Konsens ist die Aufnahme von 0,8 g Eiweiß pro Kilogramm Normalgewicht. Erkrath: „Dies kann im Einzelfall nicht oder nur schwer zu realisieren sein.“
Daher sei eine gute und fundierte Ernährungsberatung notwendig, schreibt der Diabetologe im Gesundheitsbericht. Nach den Erfahrungen ebenfalls nicht einfach ist die Reduktion der Salzzufuhr. Generell gilt: Fertiggerichte, aber auch Wurst und Käse enthalten viel Kochsalz. Selbst kochen kann helfen, zumal dann, wenn Kräuter und Gewürze genutzt werden.
Auch hierbei können professionelle Ernährungsberaterinnen wertvolle Unterstützung geben. Gelingt die Salzreduktion, wirkt sich das günstig auf den Blutdruck aus. Dagegen schwächt hoher Salzkonsum die Wirkung von Antihypertensiva ab. Sofern nicht andere Gründe dagegen sprechen, wird ein systolischer Blutdruck von 120 mmHg angestrebt.
Es überrascht nicht, dass Diabetes-Patienten mit CKD von all diesen Empfehlungen überfordert sein können. Sie aktiver als bislang in die Behandlung einzubeziehen, daran geht jedoch kein Weg vorbei, sollen erreichbare Therapieziele auch tatsächlich erreicht werden.
Es bedarf daher strukturierter Schulungen und einer integrativen Versorgung, wie sie vereinzelt in diabetologisch-nephrologischen Zentren praktiziert wird. „In den ambulanten nephrologischen Einrichtungen hat jedoch in den letzten zehn Jahren die Organisationsstruktur eine massive Umgestaltung erfahren, die diesen Kooperationsformen meistens keinen Raum mehr bietet“, kritisiert Erkrath in seinem Bericht. Einmal mehr zeigt sich: Auch moderne Medizin erfordert ausreichend Zeit und Personal.
Quelle: https://www.aerztezeitung.de/