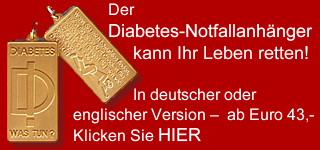Bluthochdruck: Das Präparat wechseln ist oft wirksamer, als die Dosis zu erhöhen
Hypertonie ist weit verbreitet, verschiedene Wirkstoffgruppen können den Blutdruck senken. Doch eine Studie zeigt, dass bestimmte Präparaten bei manchen Menschen besser anschlagen als andere. Woran das liegt und was das für die Therapie bedeutet.
(17.4.2023) - Bluthochdruck-Patienten könnten durch einen Wechsel ihres Medikaments möglicherweise weitaus größere Verbesserungen erfahren als durch eine höhere Dosis. Aufgrund dieser Resultate ihrer Studie plädieren schwedische Mediziner im Fachblatt „JAMA“ dafür, künftig verstärkt personalisierte Therapieansätze zu testen. Ein deutscher Experte zweifelt allerdings daran, dass sich solche Ansätze derzeit in der klinischen Praxis umsetzen lassen.
Bluthochdruck ist eine globale Volkskrankheit: 2021 ergab eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass sich die Zahl der Betroffenen in 200 untersuchten Ländern von 1990 bis 2019 auf knapp 1,3 Milliarden Menschen verdoppelt hat. Unbehandelt kann Hypertonie zu Nierenschäden, Herzerkrankungen und Schlaganfällen führen. Obwohl es mittlerweile verschiedene effektive Medikamente gibt, gelingt es nur 25 Prozent der erkrankten Frauen und 20 Prozent der Männer, damit ihre Therapieziele zu erreichen, so die WHO-Untersuchung.
Gründe dafür untersuchten nun Wissenschaftler der Universität Uppsala. Konkret ging das Team um den Kardiologen Johan Sundström der Frage nach, inwiefern sich die Wirksamkeit unterschiedlicher Blutdruckmedikamente von Mensch zu Mensch unterscheidet. Die Mediziner untersuchten an 280 Teilnehmenden, ob es ein optimales Blutdruckmedikament für jeden einzelnen Patienten und somit Potenzial für eine personalisierte Blutdruckbehandlung gibt.
Dafür nahmen die Probanden insgesamt ein Jahr lang abwechselnd vier gängige Medikamente unterschiedlicher Wirkstoffklassen – Thiaziddiuretika, ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Antagonisten und Kalziumantagonisten. Die Wirkung der Arzneien war von Person zu Person sehr unterschiedlich, und bestimmte Patienten erzielten mit einem Medikament einen niedrigeren Blutdruck als mit einem anderen. Darüber hinaus wirkte sich ein Medikamentenwechsel für viele Probanden stärker aus als die Verdoppelung der Dosis des aktuellen Medikaments.
Dieses Ergebnis stellt den Autoren zufolge die Behandlungsleitlinien zahlreicher Länder in Frage, denen zufolge die vier untersuchten Medikamentengruppen allen Hypertonie-Patienten gleichermaßen empfohlen werden. „Diese Studie liefert den Beweis, dass weit verbreitete Blutdrucksenker je nach Person unterschiedlich wirksam sind, was das Potenzial für eine stärkere Senkung des Blutdrucks durch eine personalisierte Therapie bietet“, heißt es. In einer Mitteilung konkretisiert Sundström: „Wenn wir die Medikation eines jeden Patienten individuell anpassen, können wir eine bessere Wirkung erzielen, als wenn wir ein Medikament aus einer dieser vier Medikamentengruppen zufällig auswählen.“
Für Markus van der Giet, Hypertensiologe an der Charité in Berlin, wäre ein solcher personalisierter Behandlungsansatz zwar wünschenswert, in der Praxis allerdings kaum umsetzbar: „Das würde bedeuten, Patienten hintereinander alle Medikamente durchprobieren zu lassen, was im klinischen Alltag nicht funktionieren würde und für die Patienten wahrscheinlich auch eine frustrierende Erfahrung wäre.“
Tatsächlich räumen die Autoren selbst ein, dass für eine personalisierte Therapie nach Biomarkern geforscht werden müsste, die derartige Prognosen ermöglichen würden. „Solche Biomarker sind aber längst nicht so stabil, wie man meinen könnte, sondern können im Kontext der Blutabnahmebedingungen, durch tageszeitliche Schwankungen und Temperaturveränderungen variieren“, gibt van der Giet zu bedenken.
Der Experte vermutet, dass es zweckmäßiger sein könnte, Therapien verstärkt auf Personengruppen zuzuschneiden. So würden etwa Kalziumantagonisten oder Diuretika bei älteren Patienten, deren Gefäße an Elastizität verlören, eine gute Wirkung zeigen. Betablocker seien dagegen eher bei jüngeren Betroffenen angezeigt, so van der Giet.
Quelle: https://www.welt.de/